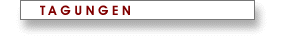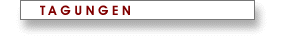
- Zur
politischen Semantik der
- Medien-
und Kommunikationstheorie
- im
20. und 21. Jahrhundert
Veranstaltet
vom Kulturwissenschaftlichen - Forschungskolleg
»Medien und kulturelle
- Kommunikation«
SFB/FK 427, Köln
- 03.07.2003-05.07.2003,
Universität zu Köln,
- Hauptgebäude,
Hörsaal XVIII
Die
Medien- und Kommunikationstheorien des 20. Jahrhunderts entstanden - trotz
Beteuerung technischer oder anthropologischer Neutralität stets im
- Spannungsfeld
zwischen sozialen Modellen und politischen Anwendun-
- gen.
Damit sind es Theorien dessen, was eine Gesellschaft im Innersten
- oder
durch äußeren Zwang zusammenhält, also auch Theorien einer
To-
- talität
oder Homöostase des Gesamtsystems. Und immer wieder ging es
- um
die Möglichkeit, Freund von Feind zu unterscheiden, sei es durch die
- semantische
Kopplung von Propaganda-Analyse und Gegenpropaganda,
- sei
es durch den zeitlichen Vorsprung der Geheimkommunikation vor ihrer
- feindlichen
Dechiffrierung. Erst aus der Kombination beider Modelle ist die
- Universalisierung
des Kommunikationsbegriffs gegen Ende des Zweiten
- Weltkriegs
entstanden.
- Die
politische Semantik dieser Theorien hat ihren Niederschlag im
- gesamten
terminologischen Erbe des 20. Jahrhunderts gefunden. Schaut
- man
genauer, fällt auf, dass die theoretischen Entwürfe der Solidarität
- sowie
der Feindschaft von dem Dritten der Unterscheidung von Freund
- und
Feind immer wieder heimgesucht werden: dem Beobachter, dem Ver-
- rat,
der unerwünschten Dechiffrierung, der entstörten oder irreparablen
- Störung,
dem Double Bind, dem Wechsel zwischen Krieg und Frieden, dem
- Parasiten
und dem »parasitic use«. In gewissen terminologischen Prägun-
- gen
gelangt dieses Dritte sogar zu einer Apotheose. Dies zeigt sich auch
- an
den Protagonisten der Kommunikations- und Medientheorien: Die Figu-
- ren
des Seitenwechsels sind in der Überzahl. Es waren wissenschaftli-
- che
oder politische Dissidenten, Überläufer und Emigranten, etwa
in den
- deutsch-amerikanischen
Spiegelungen der Kommunikationstheorie im 20.
- Jahrhundert
zwischen Propagandaforschung und Systemtheorie, empiri-
- scher
Sozialforschung und Frankfurter Schule. Es waren die "Displaced
- Person"
und der "Friendly Enemy Alien", also Personen, die jedes Null-
- summenspiel
unterliefen.
- Margret
Boveri hat zu Beginn des Kalten Krieges den Vorschlag
- gemacht,
das wichtigste ideologische Moment des 20. Jahrhunderts auch
- für
demokratische Gesellschaften oder avantgardistische Bewegungen
- in
der Figur des ðVerratsÐ zu fassen. Dies greift die Tagung auf,
indem
- sie
nach den persönlichen und kollektiven Attributionen von Freund und
- Feind,
die einen Seitenwechsel oder ein falsches ðFraternisierenÐ zum
- Verrat
werden lassen, fragt. Erweisen sich doch die Medien- und Kom-
- munikationstheorien
des 20. Jahrhunderts im Rückblick von der Figur des
- Verrats
derart geprägt, dass die Frage zu stellen ist, wie das 21. Jahr-
- hundert
auf diesen Hintergrund der Medientheorie reagiert. Behält die Un-
- terscheidung
von Freund, Feind & Verrat ihre Wirkung auf aktuelle Ent-
- würfe
der Medientheorie etwa in den abermaligen Vorwürfen, die Mas-
- senmedien
(wie vormals die Demokratie) unterliefen jede Unterscheidung
- freundlicher
und feindlicher Nachrichten, oder sie dienten vor allem (wie
- vormals
die Propaganda) zu undurchschaubar verdeckten Operationen
- und
Adressierungen? Oder zerfällt das terminologische Erbe des 20. Jahr-
- hunderts
in der Medientheorie zunehmend in seine Einzelteile - denen da-
- mit
auch der zweischneidige politische Impetus der Charakterisierung
- einer
ðtotalen sozialen SituationÐ fehlen würde?
Cornelia
Epping-Jäger: Propaganda - Albert
Kümmel: War of the Worlds Revisited
- Axel
Roch: Sehende Oberflächen. Der Blick im Zwischen
- von
Freund und Feind
- Eva
Horn: War Games. Das Wissen vom Feind im Kalten Krieg
- Claus
Pias: Der Vietkong. Rechnen als Gestalt
- Thomas
Schestag: "[...] und eigentlich noch viel jünger."
- Kafkas
Jargon
- Thomas
Hauschild: Sleepers
- Urs
Stäheli: Der Verrat des Kapitalismus
- Ralf
Klamma: Vertrauensmodellierung
- Matthias
Krings: Osama bin Laden vs. George W. Bush in
- Nigeria.
Zur lokalen Perzeption globaler Ereignisse
Kontakt:
Gabriele Schabacher SFB/FK 427 »Medien und kulturelle Kommu- - nikation«
Bernhard-Feilchenfeld-Str. 121 50969 Köln Tel. 0221/470-6770
- Fax:
0221/470-6773 E-Mail: fk-427@uni-koeln.de
http://www.uni-koeln.de/inter-fak/fk-427