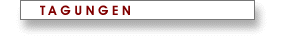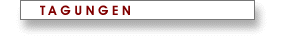
- Von
Display bis Imageneering.
- Codes
und Kontexte digitaler Bilder
Eine
Vortragsreihe der Fächergruppe Kunst- - und
Medienwissenschaften
- Verantwortlich:
Hans Ulrich Reck und Stefan Römer
- Overstolzenhaus,
Rheingasse
Die
Vorträge befassen sich mit dem Thema digitale Bildfunktionen und ihre
- Kontexte.
Sie stehen vor allem unter der Frage: Was sind die Codes? Und:
- Wie
werden sie definiert? Kann man aus den flutartig erschienenen Antho-
- logien
zum Thema »Bild« vor allem erfahren, dass die dort interdisziplinär
- versammelten
Theorien wenig gewinnbringend für die einzelnen Forschungs-
- disziplinen
sind, so ist wohl unbestritten, dass Bilder als massenmediale Er-
- scheinung
im letzten Jahrzehnt extrem an Bedeutung zugenommen haben.
- Vermutlich
muss man von dem Anspruch Abschied nehmen, dass mit einer
- Theorie
alle Bilderscheinungen erklärbar sind. Es geht bei dieser Vorlesungs-
- reihe
auch um eine Reflexion der zehnjährigen Erfahrungen an der KHM mit
- der
Ausbildung in allen Bereichen der Bildkonstruktion. Aus der Sicht der
- Kunst
und der visuellen Kommunikation werden Fragen der Bilder, der digi-
- talen
Bildtechnologien sowie der institutionellen Kunst- und Gestalteraus-
- bildung
diskutiert. Dabei wird auch die vor zehn Jahren etablierte Idee von
- der
Kunstausbildung mit »Neuen Medien« im mittlerweile veränderten
künst-
- lerisch-wissenschaftlichen
Kontext befragt.
- Die
Vortragsreihe wird durch eine Einführung in das Thema und
- eine
Schlussdiskussion nach dem letzten Vortrag begleitet. Der einzelne
- Vortrag
wird jeweils mit einer kurzen Zusammenfassung der vorherigen
- Vorträge
eingeleitet. Diese Vortragsreihe ist Bestandteil des Forschungs-
- projekt
»Informatik, künstlerische Praxis und Kunstheorie der digitalen
Bild-
- technologien«,
das Teil des bundesweiten Forschunsprojekts »Kulturelle
- Bildung
im Medienzeitalter« der Bund-Länder-Kommission ist.
Die
einzelnen Vorträge
Hans
Dieter Huber - - "Ästhetik
der Irritation"
- am
7. Mai 2002
- Der
Vortrag fragt nach der spezifischen Differenz von künstlichen Bildern
- zu
alltäglichen Wahrnehmungssituationen. Die Differenz wird bemerkt und
- irritiert
als solche. Die Frage stellt sich, wie ein Beobachter mit dieser Irrita-
- tion
umgeht, welche kognitive und soziale Funktion solche Irritationen für
- die
Entwicklung von Gesellschaft haben und welche Rolle Codes und Pro-
- gramme
dabei spielen.
- Hans
Dieter Huber ist seit 1999 Professor für Kunstgeschichte der
- Gegenwart,
Ästhetik und Kunsttheorie an der Staatlichen Akademie der
- Bildenden
Künste Stuttgart. Nach einem Studium der Malerei und Grafik an
- der
Akademie der bildenden Künste in München sowie der Kunstgeschichte,
- Philosophie
und Psychologie in Heidelberg promovierte er im Fach Kunstge-
- schichte
mit der Arbeit System und Wirkung. Interpretation und Bedeutung
- zeitgenössischer
Kunst (München 1989).
Claus
Pias - - "Bilder
der Steuerung"
- am
21. Mai 2002
- Die
Information digitaler Bilder läßt sich auf verschiedenste Weise
gestalten,
- skalieren
und optimieren. Ihre Konstruktionen oder Abstraktionen dienen da-
- zu,
Kompliziertes einfach und Langsames schnell zu regeln und zu kontrol-
- lieren.
Und es spricht einiges dafür, daß die originäre Leistung
digitaler Bild-
- formen
nicht im Fotorealismus Hollywoods zu suchen ist, sondern überall
- dort,
wo ihr Vergessen Grundlage effektiver Verwaltungstechniken ist.
- Claus
Pias ist Medienwissenschaftler an der Bauhaus Universität
- Weimar.
Arbeitsfelder: Technikgeschichte, Medientheorie. Veröffentlichun-
- gen:
Kursbuch Medienkultur (mit J. Vogl / L Engell), Stuttgart 1999; Computer
- Spiel
Welten, München 2002; Mitherausgeber mehrerer Buchreihen
Tom
Holert - - "Globalizität.
Codes und
- Repräsentationen
des Globalen "
- am
4. Juni 2002
- Welche
Role spielt das Globale in den Image-Strategien von weltweit ope-
- rierenden
Marken? Die phantasmatischen Info/Lifestylekulutren, die Konzerne
- wie
Nike oder Microsoft produzieren, um Märkte erfolgreich auf Milieus
ab-
- zubilden
(und umgekehrt), basieren auf Mythologien des Branding und der
- Globalisierung.
So entstehen Selbstbeschreibungen, die permanent zwischen
- dem
Besonderen und dem Allgemeinen, dem Lokalen und dem Globalen, der
- Differenz
und der Identität usw. vermitteln. Entscheidende Funktionen in die-
- ser
mythologischen Vermittlungsarbeit übernehmen Bilder ? nicht zuletzt
das
- Bild
des Globus.
Saberth
Buchmann - - "Unauffällige
Verwandte"
- am
2.Juli 2002
- Künstlerische
Arbeiten aus dem Umfeld der sog. Conceptual art werden er-
- örtet,
die in der Zeit zwischen 1968 und 1972 entstanden sind: Denn kenn-
- zeichnend
für diese spezifische historische Phase sind Entwürfe einer auf
- Information
gegründeten Phänomenologie der Wahrnehmung, die eine im ho-
- hen
Maß ambivalente Auseinandersetzung mit einem explizit technisch co-
- dierten
Informationsbegriffs zu Tage befördert, der beispielhaft von der da-
- mals
populären Art&Technology-Bewegung vertreten wurde.
- Sabeth
Buchmann, Kunsthistorikerin, künstlerisch-wissenschaftliche
- Mitarbeiterin
an der Universität der Künste, Berlin; z.Zt. Teilzeitvertretungs-
- professorin
an der der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, regelmä-
- ßige
Veröffentlichungen in Kunstzeitschriften; Mitherausgeberin der Künst-
- ler/innenzeitschrift
"A.N.Y.P.", Dissertation zum Thema: "Technologie als
- kulturelle
Konstruktionslogik: Exemplarische Analysen zum Produktionsbe-
- griff
in der Conceptual Art", Mitherausgeberin des Readers "geld*beat*syn-
- thetik*,
Berlin/Amsterdam 1996
Kontakt
: Dr. Stefan Roemer - Kunsthochschule
für Medien
- Peter-Welter-Platz
2
- D-50676
Koeln
- 0049-221-20189-320